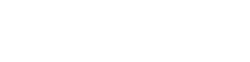„Et bliev nix, wie et wor“ sagt eine kölsche Redensart. Veränderungen gehören zum Leben und vor diesem Hintergrund suchen viele Menschen Antworten auf die zentrale Frage: „Wie gehe ich mit Veränderungen am besten um?“ Die Rheinländer haben ihre eigenen Antworten darauf gefunden, die im Folgenden beleuchtet werden. Für die einen geht es beim Stichwort Veränderung um Anpassung und für die anderen um Antizipation. Die einen sehen sich mit beruflichen Herausforderungen konfrontiert (z.B. ein neuer Job), die andern mit privaten Schicksalsschlägen (z.B. Krankheit). Die Menschen streben nach Zufriedenheit, Glück und Gesundheit. Unternehmen stellen sich diese Frage auch, wenn auch mit anderen Motiven. Sie zielen auf Kundenbedürfnisse, Marktanteile und Gewinn.
Ein Blick in die Geschichte der Menschheit zeigt dabei, insbesondere zur Überraschung der jüngeren Generationen, dass diese zentrale Frage nicht neu ist. So sagte schon der taoistische Philosoph Dschuang Dsi, der im ersten Jahrtausend vor Christus lebte: „Auf der Welt gibt es nichts, was sich nicht verändert, nichts bleibt ewig so, wie es einst war“. Das Wissen um den Ablauf von Veränderungsprozessen und die Haltungen sowie Gedanken der Beteiligten diesbezüglich ist somit ein zentraler Erfolgsfaktor für gute Veränderungsarbeit, z.B. im Business Coaching. Es macht daher Sinn, sich mit den verhaltensspezifischen Grundlagen im Change-Management vertraut zu machen. Die Wissenschaft hat unterschiedlichste Theorien entworfen, um Veränderungsprozesse zu beschreiben und daraus Vorschläge für zielorientierte Verhaltensweisen zu entwickeln. Zu nennen sind hier u.a. das 3 Phasenmodell von Kurt Lewin (1947), das 5 Phasenmodell von Elisabeth Kübler-Ross (1969), das 8 Stufenmodell von John Kotter (1995), das 7 Phasenmodell von Richard Streich (1997) oder, aus der jüngeren Vergangenheit, die Theorie U von Otto Scharmer (2007).
Aufbauend auf diese allgemeingültigen Modelle soll im Folgenden, durchaus mit einem gewissen Augenzwinkern, der regionale kulturelle Aspekt mit betrachtet werden. Gemeint ist die geistige Haltung der Rheinländer zu diesem Thema, denen in diesem Kontext besondere Fähigkeiten nachgesagt werden bzw. die es geschafft haben, sich selbst ein entsprechendes Image aufzubauen.
Ihre damit verbundene Haltung zu Veränderungsprozessen spiegelt sich wieder in mundartlichen Sprichworten, deren genaue Urheber wie auch Entstehungszeit unbekannt sind. Der Kabarettist Konrad Beikircher hat die Redensarten vor über einem Jahrzehnt erstmals zum rheinischen Grundgesetz zusammengefasst (2001) und die Kölner machten daraus ihr Kölsches Grundgesetz. Der Mentalität der Region folgend werden die Inhalte der Paragraphen (Juristen mögen verzeihen, dass nicht von Artikeln gesprochen wird) und deren Reihenfolge frei und variantenreich gehandhabt. Aus dieser Ursuppe volkstümlicher Lebenserfahrung in Kombination mit dem oben genannten 7 Phasenmodell von Prof. Streich ist mein rheinisches Veränderungsmodell für das „Change-Management op Kölsch“ entstanden.
Wer im Rahmen der Veränderungsarbeit die Gefühlslage der Betroffenen einordnen möchte, sollte den typischen Verlauf der von Prof. Streich skizzierten Veränderungskurve kennen. Nach seinem Modell aus dem Jahr 1997 beschreibt die graphisch dargestellte Veränderungskurve den Verlauf der selbstwahrgenommenen persönlichen Veränderungskompetenz im Zeitablauf. Das rheinische Veränderungsmodell kombiniert diesen Kurvenverlauf mit den Lebensweisheiten aus dem rheinischen Grundgesetz, wobei nur in drei statt in sieben Phasen unterschieden wird. Diese drei Phasen lauten: Dissonanz-, Akzeptanz- und Integrationsphase. Die Phasen beschreiben die sich wandelnde Haltung der Betroffenen gegenüber der Veränderung. In der Dissonanzphase wird der Betroffene mit der Veränderung erstmals konfrontiert. Die gewohnten Abläufen oder Strukturen scheinen gefährdet. Bei vielen Betroffenen kommt es zu einer reflexartigen emotionalen Ablehnung des Neuen und der inhaltliche Widerstand gegenüber der Veränderung formiert sich. Die sich daran anschließende Akzeptanzphase ist von einer sachlichen und emotionalen Auseinandersetzung mit den Veränderungen geprägt. Aber nur, wer die Veränderung am Ende auch für sich persönlich akzeptiert, durchläuft die Integrationsphase. Hier werden die Veränderungen im Rahmen eines zumeist iterativen Prozesses in den persönlichen Alltag übernommen.
Die Dissonanzphase – Dat gläuve isch net
Das Ausgangsniveau der Kurve beschreibt den Status Quo vor der Ankündigung der Veränderung. Hier hat sich der Betroffene in der Gegenwart eingerichtet. Alles ist vertraut und er fühlt sich in seiner gewohnten Umgebung und den vertrauten Abläufen sicher. Der Grad der gefühlten Ausgangssicherheit und seine bisherige Change-Erfahrung bestimmt seine subjektive Veränderungskompetenz in der Ausgangslage und definiert zusammen mit dem Momentum der anstehenden Veränderung den ersten Ausschlag der Veränderungskurve nach unten. Wer Veränderungsprozesse begleitet, weiß um die Brisanz der Frage nach der Ausgangslage. § 1 des rheinisches Grundgesetztes lautet „Et es wie et es“ oder auf Hochdeutsch „Es ist, wie es ist“. Diese knappe und eingängige Formulierung hat es in sich, wenn es sich um die Einschätzung von Veränderungsprozessen dreht.
Hier sind verschiedene Reaktionsmuster der Betroffenen zu unterscheiden, wenn sie durch die Veränderung aus ihrem persönlichen Gleichgewicht gebracht werden. Erstens diejenigen, die ein realistisches und klares Bild von ihrer Ausgangslage haben. Hier stimmen Selbst- und Fremdbild überein. In diesem Fall kann sich auf den originären Veränderungsprozess konzentriert werden und es müssen nicht erst kognitive Dissonanzen beim Betroffenen überwunden werden. Die Rheinländer verbinden mit dieser Redensart übrigens die Haltung, dass man den Tatsachen ins Auge sehen und dabei das Leben nehmen sollte, wie es ist und es genießen. Neudeutsch würde man vom Leben „im hier und jetzt“ sprechen. Die Rheinländer pflegen somit ein realistisches Weltbild (außer vielleicht beim 1. FC Köln) bei einer optimistischen Grundhaltung. Bei ihnen ist das Kölschglas eben halbvoll und nicht halb leer. Im Unterschied dazu gibt es diejenigen, bei denen Eigen- und Fremdbild auseinanderfallen und die von dem externen Veränderungsimpuls zunächst überrascht sind. Der dominierende Gedanke in dieser Schocksituation ist dann: „Das kann ja wohl nicht wahr sein“. Damit verbunden ist oftmals ein Gefühl der Angst vor dem Veränderungsprozess, was eine Art Lähmung im eigenen Verhalten nach sich ziehen kann. Wichtig in dieser Phase ist es, diese Ängste zu beleuchten und alternative Impulse zu setzen, die es erlauben, sich mit dem Thema konstruktiv auseinanderzusetzen.
Die Veränderungskurve beschreibt in dieser Dissonanzphase ihren ersten (unteren) Scheitelpunkt. Wer hier im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve nicht bekommt und seinen angstgeprägten Lähmungszustand nicht überwindet, verliert den Anschluss an die geforderten Veränderungen. In dieser Schocksituation kommt es darauf an, die persönliche Betroffenheit wahrzunehmen und sich einzugestehen, dass die Veränderung sowohl real als auch gegenwärtig ist und einen klaren persönlichen Bezug hat. Wer beides verneint, wird versuchen, durch ein Umdeuten der Sachlage das Thema umgehen zu können. Das Problem bei diesem Verhaltensmuster ist, dass ein Aussitzen bzw. Verdrängen der Lage das Anpassungsproblem nicht löst, sondern oftmals vergrößert. Bei den Betroffenen, die nichts von dem Anpassungsdruck wissen wollen, fällt die Lähmung besonders heftig aus. Sie leben nach der Pipi Langstrumpf-Formel „Widewitt, ich mach die Welt, wie sie mir gefällt“. Hier findet sich eine (un)bewußte Blockadehaltung mit der fatalen Folge, dass der Veränderungsprozess im Keim erstickt wird. Die Ursache ist eine falsche Einschätzung der eigenen Ausgangslage. Die Rheinländer beschreiben diese Situation in § 6 des rheinischen Grundgesetzes mit „Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet“, was übersetzt so viel heißt, wie „Kennen wir nicht, brauchen wir nicht, weg damit“.
Am ersten unteren Scheitelpunkt hat die gefühlte Veränderungskompetenz ihren ersten Tiefpunkt erreicht. Die Betroffenen fühlen sich überfordert und dem Neuen ausgeliefert. Wer diese emotionale Paralyse überwindet, beginnt sich mit der Veränderung inhaltlich auseinander zu setzen. Argumente werden gesammelt, Verbündete gesucht, der Widerstand formiert sich und erreicht am oberen Scheitelpunkt seinen Höhepunkt. Die Betroffenen sind nunmehr der Überzeugung, dass sie die besseren Argumente haben und strotzen nur so vor gefühlter Veränderungskompetenz. Es geht um den Widerstand in der Sache, der von Wut, Ärger und Skepsis begleitet ist. Dies ist eine durchaus menschliche Reaktion, ist doch jede Veränderung ein Angriff auf unser Sicherheitsstreben, das in unserer Bedürfnispyramide ganz oben steht. Die damit verbundene Gefahr ist allerdings offensichtlich, wie ein Blick in unsere eigene Geschichte und den Umgang mit Innovationen zeigt. So kommentierte Harry M. Warner, der Chef der Filmfirma Warner Brothers, im Jahr 1927 die Erfindung des Tonfilms mit den Worten: „Wer zum Teufel will denn schon Schauspieler sprechen hören“. Sicher ein schönes Beispiel für ein falsches Sicherheitsgefühl verbundenen mit einer überhöhten Selbsteinschätzung über die eigene Urteilungskraft.
Der Rheinländer ist im Übrigen keineswegs veränderungsunwillig, sondern appelliert mit dieser Redensart nur an eine kritische Geisteshaltung gegenüber Neuerungen, wobei ihm der Wandel als Grundprinzip des Lebens durchaus bewusst ist. Der Anstieg der Veränderungskurve bis zum oberen Scheitelpunkt erklärt sich durch den Beginn der sachlichen Auseinandersetzung mit dem Veränderungsinhalt seitens der Betroffenen. Bildlich gesprochen, kann man sagen, dass der Kopf den Bauch als Antreiber sukzessive ablöst. Die Dissonanz entsteht, weil der Kopf zwar rational feststellt,
dass die Veränderung nicht einfach wieder verschwindet, der Bauch aber die Veränderung emotional nicht für „gut“ befindet. Auf jeden Fall markiert der obere Scheitelpunkt der Veränderungskurve den fließenden Übergang von der Dissonanzphase in die Akzeptanzphase.
Die Akzeptanzphase – Dat jeht net fott
Für die Veränderungstreiber muss es das Ziel sein, die rationale und emotionale Einsicht zu vermitteln, dass die Veränderung notwendig ist und auf jeden Fall kommt. Es muss die Überzeugung reifen, dass die Veränderungstreiber vielleicht doch Recht haben, auch wenn man selbst noch nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll. Diese Unsicherheit spiegelt sich dann auch in dem Abwärtstrend in der Veränderungskurve wieder. Auf der einen Seite ist die Überzeugung gereift, dass die Veränderung unausweichlich ist und Sinn macht, und auf der anderen Sicht wächst die Unsicherheit im Umgang damit. Die Antwort des Rheinländers auf dieses ambivalente Gefühlt formuliert er mit den Worten „Et kütt wie et kütt“ (Es kommt, wie es kommt) und meint damit, man solle keine Angst vor der Zukunft haben. Auch hier kommt seine optimistische, vielleicht auch leicht fatalistische Grundhaltung zum Tragen.
Will man in dieser Akzeptanzphase möglichst viele Menschen im Zuge des Veränderungsprozesses mitnehmen, ist es entscheidend, eine weitere rheinische Lebensweisheit im Hinterkopf zu bewahren. Sie lautet: „Jede Jeck es anders“ (Die Menschen sind nicht alle gleich). Auch wenn es sich um eine augenscheinliche Selbstverständlichkeit handelt, wird sie in Veränderungsprozessen gerne vernachlässigt. Ursache dürfte der alte Trugschluss sein, dem viele unterliegen, weil sie von sich auf andere schließen. Tatsächlich sind die Menschen sehr unterschiedlich in ihren Wahrnehmungen und Verhaltensmustern.
Die Wissenschaft hat verschiedene Anläufe unternommen, durch eine Art Clusterung von menschlichen Verhaltensmustern eine Unterstützung bei der unterschiedlichen Ansprache zu liefern. Entsprechende Konzepte sind bekannt unter den Stichworten: Myers-Briggs-Typenindikator (1985), Reiss-Profil (1994) oder dem persolog Persönlichkeitsmodell (2004).
Für die Umsetzung von Veränderungsprozessen würde es sich demnach empfehlen, typengerechte Kommunikations- und Überzeugungsansätze zu praktizieren, um den unterschiedlichen Bedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden. Tatsächlich findet man in der Realität solche differenzierten Ansätze kaum. Dies mag auch ein Grund dafür sein, warum eine nicht unerhebliche Zahl an Betroffenen in Veränderungsprozessen argumentativ einfach verloren gehen. Dies gilt insbesondere für den zweiten (unteren) Scheitelpunkt in der Veränderungskurve. Hier geht es nach der sachlichen Akzeptanz der Veränderung nun um die emotionale Akzeptanz derselben. Dieser Wendepunkt umschreibt den emotionalen Umkehrpunkt, an dem die Betroffenen entweder die Veränderung akzeptieren („eigentlich haben die Recht“) oder die Veränderung ablehnen („macht das ohne mich“). Es ist somit eine Entweder/ Oder-Situation. Der Rheinländer stellt sich in der Phase die mehr oder weniger rhetorischen Frage aus § 7 des rheinischen Grundgesetzes „Wat wellste maache?“ (Was willst Du machen?) und fügt sich eher seinem Schicksal, als mit dem Neuen zu hadern. Dies wird auch anhand der direkt mitgelieferten pragmatischen Begründung des § 4 aus dem rheinischen Grundgesetz deutlich: „Watt fott es, es fott“ (Was weg ist, ist weg). Die damit verbundene Aufforderung könnte man umschreiben mit „Jammere den Dingen nicht nach“.
Hier darf aus Sicht der Wissenschaft gerne auch widersprochen werden. Eine durchlebte Trauerphase ist durchaus produktiv, wenn es um die Akzeptanz des Neuen geht. Wer hier den Beteiligten kein Gehör und keine Zeit schenkt, der guten alten Zeit nachzutrauen, verlängert nur die Phase des Anpassungsleidens. Ist das Tal der Trauer durchschritten und die Betroffenen haben die Veränderung auch emotional akzeptiert, kommen wir in die Integrationsphase von Veränderungsprozessen.
Die Integrationsphase – Dat probeere isch us
Nach der Akzeptanzphase folgt die Integrationsphase, zumindest für diejenigen, die aufgrund der Veränderung weder physisch (z.B. vertragliche Kündigung) noch mental (z.B. innere Kündigung) ihr Umfeld verlassen haben. Sie haben die Veränderung sowohl sachlich als auch emotional akzeptiert und müssen jetzt lernen, mit ihr umzugehen. Das Ziel ist die Integration des Neuen in den Alltag, daher auch die Bezeichnung Integrationsphase. Im täglichen Umgang mit der Veränderung geht es darum, das eigene Verhalten zu verändern. Zum Beispiel sind eventuell neue Regeln zu beachten, Abläufe anzupassen, mit anderen Menschen zu interagieren oder Aufgaben zu erfüllen. Die tägliche Erfahrung mit den Neuerungen kann durchaus ambivalent sein. Einerseits Neugier und Glück, andererseits Frust und Ärger.
Für eine erfolgreiche Integration des Neuen in den Alltag sind dabei mehrere Dinge entscheidend. Werden diese Erfolgsfaktoren des Change-Managements in der Praxis vernachlässigt, kann dies einen Erklärungsansatz liefern, warum der Veränderungsprozess vielleicht ins Stocken geraten ist bzw. den Betroffenen Probleme bereitet:
- Es empfiehlt sich, in kleinen Schritten vorzugehen. Dies reduziert die Unsicherheit bei den Beteiligten und erhöht die Machbarkeit.
- Es ist förderlich, wenn schnell erste Erfolge sichtbar werden. Sog. Quick wins fördern die positive Grundhaltung gegenüber der Neuerung und sind damit besonders motivierend.
- Misserfolge bei den ersten Schritten sind systeminhärent. Es geht um trial and error. Entscheidend ist, offen und positiv damit umzugehen. Nicht die Schuldfrage steht im Vordergrund,
sondern die Frage nach notwendiger Qualifizierung, um eine Wiederholung von Fehlern zu vermeiden. - Noch eventuell vorhandene einzelne Widerstände im System müssen konsequent und schnell überwunden oder beseitigt werden. Hier ist auch eine gewisse Härte gefragt.
- Die Veränderungstreiber sollten konsequent mit den Vorteilen einer Integration argumentieren, erste Erfolge würdigen und für die notwendige Unterstützung sorgen.
Übergeordnetes Ziel in dieser anfangs wechselhaften Aufwärtsphase der Veränderungskurve ist es, ein Gefühl zu schaffen, dass es sich lohnt, das „Neue“ auszuprobieren. Von der Sache überzeugt, gilt es ans Werk zu gehen und die Neuerungen in kleinen Schritten auszuprobieren. In der Praxis liegen Erfolg und Mißerfolg dabei oft nahe beieinander. Einiges funktioniert auf Anhieb sehr gut und motiviert für weitere Schritte. Anderes misslingt und Frustration macht sich breit. Die neuen Dinge müssen öfters wiederholt werden, bis sich Erfolgserlebnisse einstellen. Hier wird die Veränderungsarbeit anstrengend. Die persönlich wahrgenommene Veränderungskompetenz lässt die Veränderungskurve in dieser Phase amplitudenmäßig ausschlagen. Der Rheinländer kommentiert die damit verbundenen emotionalen Tiefschläge auf seine besondere Art mit „mäht nix“ (mach nichts). In seiner Denkwelt gehört Hinfallen zum Leben. Mit positiver Energie heißt es für ihn aufstehen und weitermachen. Wieder ist es seine positive Grundhaltung, die ihn auszeichnet und nach vorne bringt.
Mit zunehmenden Erfolgserlebnissen kommt dann auch Ruhe ins System. Die Erkenntnis wächst, welche Veränderungsprozesse funktionieren und damit wächst auch die Zuversicht. Es macht sich der Gedanke breit, dass es besser funktioniert als anfangs gedacht und dass sich die Anstrengungen lohnen. So wird in § 3 des rheinischen Grundgesetzes beruhigend resümiert: „Et hät noch immer jot gegange“ (Es ist noch immer gut gegangen). Was so viel heißen soll, wie lerne aus der Vergangenheit und es gibt keinen Grund zu verzweifeln. Letztlich gibt es immer eine Lösung und alles wird gut.
Am Ende des Veränderungsprozesses steht dann die vollständige Integration des Neuen in den Alltag. Nicht nur die Geisteshaltung, sondern auch das Handlungsspektrum hat sich verändert. Die eigenen Fähigkeiten sind gewachsen, ebenso wie auch der Erfahrungsschatz im Umgang mit Veränderungen. Das Selbstvertrauen und die eigene Veränderungskompetenz hat ein neues höheres Niveau erreicht als vor dem Start des Veränderungsprozess. Die Veränderung ist selbstverständlich geworden. Vorausschauend ist dem Rheinländer aber immer auch genauso bewusst, wie es weitergeht. In § 5 des Rheinischen Grundgesetzes heißt es: „Et bliev nix wie et wor“. Die Redensart „Es bleibt nichts, wie es war“ unterstreicht die Erkenntnis, dass Wandel zum Leben gehört und man sich daher auch nicht auf dem alten liebgewonnenen Status ausruhen sollten, sondern der kommenden Veränderung mit der positiven Erfahrung der Vergangenheit entgegen gehen sollte.
Die Begleitung von Veränderungsprozessen ist eine permanente Herausforderung im beruflichen Alltag. Entscheidend für den Erfolg sind die adäquate Haltung gegenüber Veränderungen und ein ausgeprägtes Wissen für den Umgang mit Veränderungen. In diesem Sinne kann man sich im Change-Management von den Rheinländern einiges abschauen.